|
Buchempfehlung |
|

 DeiFin - das E-Book
DeiFin - das E-Book
|
Die weltweiten Finanzmärkte haben sich
in den vergangenen Jahren, nicht zuletzt wegen des Aufkommens und des
mächtigen Aufschwungs von sogenannten Finanzinnovationen, mit einer
Lebhaftigkeit gewandelt, die uns wieder und immer wieder in Erstaunen
versetzen kann. Wer sich heutzutage eifrig mit dem Fachgegenstand der
Börsen und Finanzen befasst, wird sich kaum des Eindrucks einer schillernden
Vielfalt von Anlageformen erwehren können. Man sieht sich unweigerlich
einer bunten Musterkarte von Finanztiteln gegenübergestellt, die alle
erdenkliche Anlageklassen samt ihren Zwischenstufen überspannt: angefangen
von Stamm- und Vorzugsaktien, Rentenpapieren herkömmlichen Stiles in
dieser oder jener Währung, über verschiedenartige Schuldverschreibungen
mit zum Teil exotischen Zügen, von diesen hinüber zu den ETFs und Investmentfonds
hinweg bis zu den derivativen Finanzinstrumenten, verkörpert durch "bedingte"
und "unbedingte" Termingeschäfte.
Nicht genug an dem stößt man endlich auf allerlei facettenreich ausgestaltete
Mischformen und Spielarten von Finanzderivaten in einer ungeheuren Gestaltenfülle,
wie sie unlängst mancherlei Optionsscheine ("warrants") und sogenannte
"strukturierte Finanzprodukte", also Zertifikate, Hebelprodukte und
Anlagen artverwandter Natur, hervorgebracht haben. Nun wäre es kurzsichtig,
die Gegebenheit der Vielgestaltigkeit der Finanzinstrumente zu verkennen;
sie ist beileibe kein Selbstzweck, sondern jedes von ihnen trägt in
Wahrheit seine wirtschaftliche Daseinsberechtigung von vornherein an
sich. Es gibt nirgends ein Finanzderivat von Wert, das sich nicht durch
einen eigensten Aufgabenbereich auszuzeichnen wüsste, wo es das Höchste
leistet und es unter allen das vorzüglichste ist. Eindeutig angewiesen
wird einem jeden derivativen Instrument das ihm zukommende Anwendungsgebiet,
bei aller Verschiedenheit im Einzelnen, durch einen fest umrissenen
Wirkungskreis, in dem es seine wesensgemäß zuerkannte Aufgabe sichtbar
gekonnt zu bemeistern versteht.
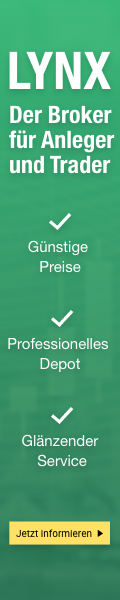
Die schwungkräftige Fortentwicklung auf
dem Gesamtgebiet der Finanzinnovationen hat unter maßgeblichem Einfluss
der modernen Finanzierungsforschung den Marktteilnehmern Zugang zu einem
weit verzweigten und in mancher Hinsicht völlig neuartigen Betätigungsfeld
verschafft, mit der unausbleiblichen Folge eines sprunghaft gestiegenen
und noch stetig wachsenden Informationsbedarfs über die Anwendungsvoraussetzungen,
besonderen Funktionen und Risiken der verschiedenen Finanzinstrumente,
namentlich bei den in Bezug auf Zahl und Vielschichtigkeit kaum noch
überschaubaren Finanzderivaten.* Das vordringliche Bestreben
jedes auf diesem Felde Tätigen kann darum kein anderes sein, als mit
dem ferneren Entwicklungsgang der Märkte Schritt zu halten, um sich
so den gesteigerten und erweiterten Anforderungen gegenwärtiger wie
auch künftiger Finanzmärkte in ihrer gesamten Tragweite in jedem Augenblick
gewachsen zu zeigen.
[* Anmerkung: Gemessen
am Gegenwert aller ausstehenden Finanzderivaten zugrunde liegender Güterklassen
umfasst der Markt für Derivate ein Vielfaches des Welt-Bruttoinlandsproduktes
zu Marktpreisen. So betrug laut
BIZ der vorgestellte
Wert ("notional value") allein aller ausstehenden OTC-Finanzderivate
Ende Juni 2023 etwa 714,74 Billionen US-Dollar – das ist eine Zahl,
die für sich spricht. –
Eine Randbemerkung: Der
Gattungsname Finanzinnovation ist nicht immer angemessen. In
der weitaus überwiegenden Mehrzahl der im Bank- und Börsenverkehr anzutreffenden
Formen von Finanzinnovationen dreht es sich in Wahrheit nämlich nicht
um neue Errungenschaften oder Erfindungen von bahnbrechender Bedeutung,
wie der sprechende Ausdruck nahelegt. Tatsächlich verkörpern diese oft
nur Abwandlungen, Mischungen oder Neubelebungen von Althergebrachtem,
begrenzt lediglich durch den Einfallsreichtum in der Vertragsgestaltung.
Im Folgenden sei der Begriff der Finanzinnovation allein den Finanzprodukt-Innovationen
zugesprochen. Auf Finanzinnovationen trifft man freilich nicht bloß
an den Terminmärkten, sondern auch an den herkömmlichen Finanzmärkten
sowie unlängst auch an den unter dem Begriff
Web3
bekannten Märkten neusten Zuschnitts, wo sich prächtige Entfaltungsmöglichkeiten
dafür darbieten.]
Derivative Finanzinstrumente
lassen sich nach einmütigem Rechtsverständnis umschreiben als Termingeschäfte,
deren Wert sich in eindeutig bestimmbarer Weise ableitet von mindestens
einer der Beobachtung vorliegenden (originären) Variablen (= derivative
Finanztitel, "Derivativgeschäfte"). Für eine solche Veränderliche in
Betracht gezogen werden kann z.B.
der Kassakurs eines Börsenpapiers, wie der einer Aktie, eines ETF, einer
Anleihe oder eines anderen Finanzinstruments, der Spotmarktpreis einer
Ware so gut wie eine Inflationsrate, Volatilität oder selbst eine Wetterkunde
oder Emissionsberechtigung.* Begründet werden Termingeschäfte
durch Willenseinigung zweier Vertragsparteien über den Kauf oder Tausch
eines nach Qualität wie Quantität festbestimmten Wirtschaftsgutes oder
Rechtes, wobei Vertragsabschluss und Erfüllung
zeitversetzt statthaben und
i.d.R. deutlich auseinanderfallen.
Diese äußere Eigenschaft eines Zeitaufschubs beim Vollzug ist überhaupt
kennzeichnend für den ganzen Inbegriff von Finanzmarktderivaten (zeitliches
Differenzmoment). Der instrumentale Charakter eines Finanzderivats wieder
ist nichts diesem geradezu Anhaftendes, keine ihm "inhärente Eigenschaft",
sondern weist zurück auf die eigentümlichen Bedingungen, die für den
finanztechnischen Zweig bestimmend sind, wo es als ein brauchbares Werkzeug
erkannt und in unterschiedlichster Ausgestaltung zweckgerecht zum Einsatz
gebracht wird. Derivative Finanzinstrumente können darum stets nur für
fachmännisch geschulte Anwender ein taugliches Instrument abgeben.
[* Vgl. etwa
§2 Abs.2
Gesetz über den Wertpapierhandel (Wertpapierhandelsgesetz - WpHG) die
Definition des Derivatebegriffs des deutschen Gesetzgebers.]
Die Finanzpraxis hat eine ganze Reihe
von Formen hervorgebracht, in denen sich Termingeschäfte verwirklichen
können. So zeichnen sich Termingeschäfte als solche erkennbar durch
eine ungemeine Vielseitigkeit aus, als sie zweckgerichtet in Abhängigkeit
zu allerlei anderweitigen Rechtsgeschäften und Fremdereignissen eingesetzt
werden können. Die Vielheit und die zum Teil eigentümlich komplizierte
Natur ihrer Erscheinungen macht es schier zur Unmöglichkeit, diese in
ihrer Gesamtheit nach abstrakten Merkmalen unter einen wissenschaftlich
gehaltvollen, in sich geschlossenen Begriff zu fassen. Die Aufstellung
eines einhellig anerkannten festumgrenzten Derivatebegriffs steht bis
heute jedenfalls noch aus. Einen Pauschaleindruck von der Weitschichtigkeit
der Erscheinungsformen derivativer Finanzinstrumente vermittelt folgende
Auflistung allein der bedeutendsten Derivate ("core derivatives"):
Derivative Finanzmarktinstrumente (oder Derivate; verkürzt aus
engl. "derivative financial instruments") umfassen schwergewichtig
Vertragsformen, wie namentlich Futures (Terminkontraktgeschäfte),
Forwards (die klassischen
Termingeschäfte einschließlich "forward rate agreements, FRA"),
Optionen des Finanzmarktes und die darauf
gründenden Swaps sowie Caps, Floors, Collars als auch Swaptions ("forward
commitments", "contingent claims"). Der kernhafte Name "derivativ"
(lateinisch von derivare, »ableiten«) deutet bereits darauf,
dass der Kurs oder Wert von Finanzderivaten der Grundregel nach von
der Kurs- oder Wertentwicklung eines zugrunde liegenden, bereits eingeführten
Marktgegenstandes ("underlying asset") abhängt.* Die Frage
der Verbriefung ist für die Einordnung als Derivat hingegen belanglos.
[* Um dies gleich
vorauszunehmen, sei in dieser Note auf die Tatsache aufmerksam gemacht,
dass der leitende methodische Ansatz zur Wertbestimmung von Derivaten
vorzugsweise und schwerpunktmäßig auf Arbitrageüberlegungen beruht.]
Derivate Instrumente entstehen auf den
Terminmärkten. Terminmärkte zählen zu den Zukunftsmärkten,
die sich mit den Spot- und Kassamärkten wechselseitig ergänzen. Terminmärkte
bestehen, weil wirtschaftliche Unsicherheiten im Geschäftsleben unvermeidbar
sind und Menschen auch bei gleichem öffentlich zugänglichem Wissen unterschiedliche
Erwartungen bilden.
Die inhaltliche Formgebung der derivativen
Instrumente ist vom Grundgedanken und in ihrer Fügungsweise – Festlegung
des Vertrags jetzt, Erfüllung später – keine Errungenschaft zeitgemäß
vorgeschrittener Finanzmärkte heutiger Prägung, sondern etwas geschichtlich
Gewordenes. Der Ursprung derivativer Finanzinstrumente reicht über die
Zeit weit zurück bis tief in die Antike, wo Phönizier bereits vor gut
3500 Jahren regelmäßig Zeitgeschäfte
auf landwirtschaftliche Erzeugnisse abschlossen und bald darauf, nunmehr
in Gestalt der Seeversicherung, diese auch für überseeische Schiffsladungen
sowie für anderweitige wichtige Handelsgüter betrieben, um mit ihrer
Hilfe der wirtschaftlichen Unsicherheit füglich Herr zu werden.
Seither nahm der Terminhandel einen immer
größeren Aufschwung. Als eigentliche Triebkraft, die Anfang der Siebzigerjahre
des verflossenen Jahrhunderts dem eingeläuteten Siegeszug der Finanzderivate
an den Welt-Terminmärkten zu durchschlagendem Erfolg verhalf, erwies
sich zweifellos der sowohl von bedeutenden überstaatlich operierenden
Institutionen als auch von einer ganzen Reihe multinationaler Unternehmungen
wiederholt vorgebrachte Wunsch nach ebenso bequem zu handhabenden wie
wirksamen Sicherungsinstrumenten gegen die überbordenden Preisrisiken,
die seinerzeit von den merklich gestiegenen
Volatilitäten in und zwischen
den verschiedenen Güter- und Finanzmärkten ausgingen. Seitdem man erkannt
hat, dass Finanzderivate, wie Forwards, Futures, Swaps und Optionen
des Finanzmarktes es sind, ein für Kurssicherungszwecke vortreffliches
Mittel darbieten, ist ihr Umsatzaufkommen an den weltweiten Bank- und
Börsenplätzen buchstäblich ins Ungeheure angewachsen und im gleichen
Zuge haben sie eine überragende wirtschaftliche Bedeutung ohnegleichen
erlangt. Der Verkehr in diesen Instrumenten übersteigt jegliche Vorstellungskraft,
zumal da aller Voraussicht nach sein Ausmaß sich in absehbarer Zukunft
noch weiter vermehren wird.
Eine nicht minder schwungvolle Ausbreitung
und Geltung an den Finanzmärkten hat in den letzten drei Dezennien die
Gattung der eher als traditionell eingestuften, eigens ausgehandelten
Devisentermingeschäfte durchlaufen, was ungeschmälert auch von dem ansehnlichen
Strauß der Zins- und Währungsswaps sowie gerade in jüngerer Zeit insbesondere
von dem der Kreditderivate gilt. Eine stattliche Reihe weiterer optionsähnlicher,
nicht standardisierter Produkte, wie Caps, Floors, Collars, Swaptions
u.a., die von Berufshändlern
im großen Maßstab an den Börsen vorbei auf den sogenannten Over-the-Counter-Märkten
(OTC) umgesetzt werden, beleben ihrerseits das Bild. Darüber hinaus
trifft man im Rahmen von Obligations- oder Aktienemissionen namhafter
Unternehmungen nicht selten auf Finanzderivate, die dem ausgesprochenen
Zweck nach einen wesentlichen Bestandteil ihrer Bilanz- und Finanzierungspolitik
bilden. Zum Kreis der Nutzer von Finanzderivaten gehören im Einzelnen
vornehmlich: Kapitalanlagegesellschaften, wie Bankhäuser und Investmentfonds
es sind, aber auch Versicherungen sowie multinational ausgerichtete
Konzerne zählen in ihren Reihen, dazu kommt eine stattliche Zahl von
betriebsamen Vermögensverwaltern und sonstigen Kapitalsammelstellen,
ebenso wie manche Großhändler, ferner die öffentliche Hand und nicht
zum wenigsten der Privatanleger.
Der börslich ermittelte, öffentliche bekannt
gemachte Preis (Börsenpreis, Kurs, "Terminpreis") von derivativen Finanzinstrumenten
ist – bei aller Verschiedenheit im Einzelnen – im Wesen der Sache notwendig
ein mittelbarer. Ein solcher findet sein Richtmaß erst in ursprünglichen
Größen, das ist eine hergebrachte, ihm zugrunde liegende Variable, also
für gewöhnlich der auf dem Spot- oder Kassamarkt des unterliegenden
Instruments herrschende Marktpreis. Eine börsengehandelte Aktienoption
etwa ist ein derivatives Instrument, dessen Preis (Optionsprämie) vom
Kurswert einer bestimmten ihr zugrunde gelegten Aktiengattung abhängt.
Preise, Werte und Zahlungsmerkmale derivativer Instrumente können
sich, wie oben angedeutet, darüber hinaus herleiten von allerhand anderweitigen
verifizierbaren Bezugsgrößen, wie etwa den Preisen der hauptsächlichsten
Welthandelswaren ("commodities"),
Devisenkursen, Referenzzinssätzen, Aktien und deren Indices, Inflationsraten,
Eintrittswahrscheinlichkeiten von Kreditausfällen usw. bis hin zu Mengen
an Schadstoffemissionen oder gar Wetterdaten.
 Mit dem Depot über LYNX handeln Sie Futures ab 2,00 Euro! Jetzt Depot
über den Futures-Broker LYNX eröffnen
Mit dem Depot über LYNX handeln Sie Futures ab 2,00 Euro! Jetzt Depot
über den Futures-Broker LYNX eröffnen
Ein wiederholt hervortretender Grundzug,
den eine ganze Anzahl von Finanzderivaten schon wegen ihrer inneren
Wesensbeschaffenheit gemein hat, liegt in dem Umstand, dass ihr Preis
die Preisentwicklung ihres Basisgegenstandes in einem festgesetzten
Verhältnis eines bestimmten Vielfachen augenblicklich nachvollzieht
(Hebel- oder Leverage-Effekt).
Oft genügen die geringfügigsten Wertänderungen beim untergebenen Marktgegenstand,
um verhältnismäßig große Wertänderungen beim darauf gehandelten derivativen
Instrument hervorzubringen ("gearing"). Dieser Befund bietet
häufig und gerne den eigentlichen Anreiz zum spekulativen Handel mit
derivativen Instrumenten. Dank den damit verbunden gehobenen Gewinnaussichten
selbst bei nur mäßigen Kursänderungen beim Bezugsobjekt vermag denn
auch der glücklich arbitrierende Händler durch Geldeinsatz von vergleichsweise
geringen Summen auf kurze Frist an Erfolg versprechenden Zukunftsaussichten
des ferneren Börsengeschehens überverhältnismäßig teilzuhaben (Trading).
Allerdings hat die Hebelwirkung von Termingeschäften auch ihre Kehrseite.
Diese prägt sich durch ein entsprechend hoch anschlagendes Verlustrisiko
insofern aus, als nicht allein positive, sondern auch negative Wertentwicklungen
im Geschäftsergebnis multiplikativ zum Ausdruck kommen.
Mit dem Gebrauch zu Spekulationszwecken,
sei es in steigender, sei es in fallender oder selbst bei fortbestehender
Entwicklungsrichtung eines Marktes, ist der Nutzinhalt derivativer Instrumente
doch längst nicht erschöpft. Neben der Verwendungsweise zur Differenzspekulation
und, in einem weiteren Verstand, auch zur Ausnützung von Preisungleichgewichten
(Arbitragen) finden diese nach ihrer besonderen Eigenart nämlich
in der Absicherung gegen bestimmt gegebene Preis- bzw. Kursrisiken ihre
vorzügliche Verwertbarkeit (Hedging).*
Nicht ohne Grund spiegelt sich in der höchst wirkungsvollen, trotzdem
vergleichsweise kostengünstigen, transparenten und zudem leicht zu handhabenden
Einsatzmöglichkeit als Kurssicherungsinstrument im Rahmen des betrieblichen
Risikomanagements die zentrale wirtschaftliche Bedeutung derivativer
Finanzinstrumente unmittelbar wider.
[* Den einzelnen
oben aufgeführten Beweggründen zur Teilnahme am Terminhandel, also denen
eines Trading-Motivs, Arbitrage-Motivs und Wertsicherungsmotivs, reiht
sich im Falle von Warenderivaten (Commodities) noch das Diversifikationsmotiv
an.]
So buntscheckig und ungleichartig wie
die ganze Fülle von Finanzierungstiteln und Finanzkontrakten sich im
fortschrittlichen Wirtschaftsleben unserer Zeit auszuprägen versteht,
so buntgemischt und ungleich sind Denkweisen, Einstellungen und Risikoneigungen
unter den Handeltreibenden an den Finanzmärkten verteilt. Die Mannigfaltigkeit
der Interessenlagen legt es nun nahe, im Fortgang der Untersuchung die
Gesamtheit der Marktteilnehmer nach ihrem Transaktionsmotiv in drei
voneinander klar abgrenzbare Gruppen zu scheiden: Es sind dies die Gruppen
der Spekulanten, der
Hedger und der
Arbitrageurs. An dieser Leitvorstellung
der Dreiteilung, deren Einteilungsgrund sich eng an die wirtschaftliche
Zweckbestimmung von Derivaten anlehnt, sei auf den nachfolgenden Seiten
der Inhalt dieser Abhandlung über Futures in seinen Hauptzügen weiter
entwickelt und genauer beleuchtet.

|
Futures |
|
Rechtlich
treffend umschrieben stellt ein Terminkontraktgeschäft
= Futures-Kontrakt
("contract for future delivery"...
>>
|
|
Futures
sind für einen schwungvollen Markthandel wie geschaffen.
Jeder gesicherte, wohl ausgebildete Marktverlauf
ist freilich an gewisse Voraussetzungen und Regeln
gebunden. Für einen vorschriftsmäßigen Handel ...
>>
|
|
Aktienindex-Futures
("stock index futures") werden zusammen mit
Devisen-, Zins- und anderen Index-Futures der Gruppe
der "financial futures" zugeordnet.
>>
|
|
|
Hedging mit Finanzderivaten |
|
Unter
einem Hedge (vom englischen "to hedge", »sich
mit einer Hecke abgrenzen; absichern gegen Risiken«)
versteht man ein Versicherungsprodukt ...
>>
|
|
Wie
die Wirtschaftsgeschichte lehrt, unterliegen Wechselkurse
zuweilen jähen und besonders heftigen Schwankungen.
Dies ist in Systemen flexibler Wechselkurse ...
>>
|
|
Die
sachgerechte Handhabung von Aktienportfolios (Portfolio-Management),
im Besonderen die Steuerung von Aktienkursrisiken,
beruht weithin auf dem Einsatz von Finanzderivaten
...
>>
|
|
|
Märkte |
|
Laufende
Kurse von den weltweiten Termin- und Aktienbörsen,
Kurslisten, Nachrichten, weiterführende Links ...
>>
|
|
Alles
rund um den Devisenhandel: Echtzeitkurse, die Währungen
der Welt, Währungskürzel, Währungsrechner ...
>>
|
|
Echtzeit-Kurse
von den Edelmetallmärkten: Gold, Silber, Platin
und Palladium.
>>
|
|
Laufende
Preise für Bitcoin, Ethereum u.a.
in Euro und Dollar.
>>
|
|

|